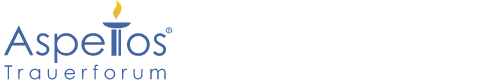Ich weiß nicht, ob ich hier ganz richtig bin, denn mein Vater ist noch gar nicht gestorben. Er hat aber jetzt schon so lange Parkinson, dass ich den Menschen, der er eigentlich einmal war, schon verloren habe. Ich hoffe, es ist daher in Ordnung dass ich hier schreibe - auch wenn er eigentlich noch lebt.
Ich bin 43 Jahre alt und habe bisher das Glück gehabt, noch nie jemand wirklich Wichtigen in meinem Leben zu verlieren. Und jetzt gleich mein Vater - eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Er hat vor fast 15 Jahren Parkinson bekommen. Damals waren wir erschrocken, aber er war schon 65 und die ersten zehn Jahre mit der Krankheit waren in Ordnung. Sie waren von Einschränkungen gekennzeichnet, aber vieles ging auch noch sehr gut. Wir sind keine Familie in der viel über Gefühle oder gar über den Tod gesprochen wird, auch keine spirituelle oder religiöse Familie. Daher hat mein Vater alles Organisatorische erledigt. Er hat die Vorsorge- Gesundheit- und Finanzvollmachten verteilt, seinen Nachlass geregelt und mit uns besprochen, dass er möglichst wenig medizinische Eingriffe möchte. Worüber er nie gesprochen hat, war - wie er sich mit dieser Krankheit fühlt oder wie es sein wird Abschied zu nehmen. Da er in so Vielem mein Vorbild war, habe ich, als er vor fünf Jahren deutlicher von der Krankheit gezeichnet wurde, versucht, es ihm nachzutun. Ich habe versucht die Probleme "wegzuorganisieren". Er hat alle Pflegestufen bekommen, den Pflegedienst, die Tagespflege, alle Hilfsmittel, alles damit er - wie es sein Wunsch war - zu Hause bleiben konnte. Aber je mehr er sich veränderte, desto mehr versuchte ich auch Abstand zu bekommen - ich hatte mir zwar ein halbes Jahr Pflegezeit für ihn genommen, bin aber immer weniger gern hingefahren (ich wohne 400km weit weg), die Besuche wurden immer schwieriger für mich, ohne, dass ich mir eingestehen konnte, dass ich trauere, um den Menschen, der eigentlich schon nicht mehr da ist.
Dann kam der Tag im Februar 2020, an dem ich im Haus meiner Eltern aufwachte und meine Mutter mir besorgt mitteilte, dass sie Vati nicht aufwecken kann. Auch ich bekam ihn nicht wach, aber er atmete noch, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Dann kam die Pflegedienstfrau - mehr auf Zack als ich - die den Puls nahm und mir zurief, ich solle sofort die 112 anrufen. Ich hab nur noch funktioniert. Meinen Vater nach Anweisung des Menschen am Telefon auf den Boden gelegt, Herz-Lungen-Massage gemacht, ihn in die stabile Seitenlage gebracht. Zugesehen, wie ein Rettunghubschrauber auf der Wiese nebenan landete, ein Notarztwagen kam, Feuerwehrleute in schweren Stiefeln in sein Zimmer liefen. Die Stiefel sind mir immer noch vor Augen, schon damals dachte ich - sie gehören nicht hierher. Irgendwann kam eine Ärztin zu mir, und sagte mir was ich tun solle. Als sie die Papiere erwähnte, die ich mit ins Krankenhaus bringen solle, wurde mir schlagartig klar, dass mein Vater eine Patientenverfügung hat und, dass er nicht wiederbelebt werden wollte. Ich schaute meine Mutter an, die nicht richtig verstand, was das Problem war. Eine Stunde später im Krankenhaus, wachte mein Vater mit den Worten "hättet ihr mich doch nur gelassen" auf. Es war schrecklich, ich hätte es anders entscheiden sollen. Heute glaube ich, dass ich es nicht getan habe, weil ich mich noch nicht von ihm verabschiedet hatte, aber ich wünsche mir, wir hätten uns einen Stuhl genommen und daneben gesetzt, seine Hand gehalten und ihn zu Hause einschlafen lassen.
Am Tag darauf bin ich wieder nach Hause gefahren, habe weiter gearbeitet, dann kam Corona, in der ersten Lockdownwoche bekam meine kleine Tochter eine Lungenentzündung, niemand teste sie, wir versuchten in Quarantäne zu bleiben. Die Angst und Unsicherheit setzten mir sehr zu und ich merkte, dass ich gar nicht mehr logisch und ruhig denken konnte, ich hatte nur noch Angst und Panik die Kontrolle über alles zu verlieren. Irgendwann wurde ich krank und nicht mehr richtig gesund. Irgendwann hörte sich mein Hausarzt alles an, was passiert war, schrieb "Posttraumatische Belastungsstörung" auf die Überweisung und schickte mich mich zum Psychologen. Das hat sehr geholfen, hat mir geholfen einen Zugang zur Trauer zu finden, aber ich finde es unglaublich hart.
Mein Vater ist schon so weit weg. Er kann kaum noch sprechen, hat schwere Halluzinationen, fällt ständig um, hat Schmerzen. Letzte Woche hat die Tagespflege angedeutet, dass es nicht mehr lange gehen wird, mit zu Hause (meine Mutter ist auch fast 80) und Tagespflege. Mein Vater soll ins Heim und ich fühle mich wieder schrecklich. Ich hätte ihm so gern den Wunsch erfüllt zu Hause sterben zu können, einen Tod zu haben ohne all das, was er nicht wollte. Und diese Schuld macht es mir grade so schwer. Ich weiß, dass das damals eine Momententscheidung war - wir hatten noch nicht mir einer Nahtodsituation gerechnet und uns daher nicht darüber unterhalten, was wir machen würden. Aber trotzdem...es wäre das gewesen, was er sich gewünscht hätte. Jetzt muss er ins Heim und ich habe das Gefühl versagt zu haben. Es ist so schwer, sich mit dieser Schuld von ihm zu verabschieden. Ich habe das Gefühl, ihm einen so wichtigen Wunsch nicht erfüllen zu können. Bisher dachte ich: wenn er gehen will, dann wissen wir, dass wir es diesmal anders entscheiden, aber jetzt wird das passieren, was er nicht wollte. Mir geht es damit wieder sehr schlecht und ich weiß nicht gut, wie ich da heraus kommen soll.
Ganz lieben Dank fürs Lesen dieses langen und sicher konfusen Textes.